Frühere islamische Gelehrte wie Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam al‑Shafiʿi und Imam Ahmad ibn Hanbal betonten übereinstimmend, dass Kleidung den Grundregeln der Scharia entsprechen muss (Bedeckung der ʿAwrah, keine Durchsichtigkeit, keine übermäßige Zierde). Gleichzeitig sagten viele Gelehrte, dass die Form und Art der Kleidung an Kultur und Zeit angepasst werden darf, solange diese Prinzipien gewahrt bleiben.
📖 Detaillierte Erklärung
- Hanafi-Regel zum Qasr (Kürzen): Für Hanafis ist das Kürzen der vier Rakʿāt-Gebete (Dhuhr, Asr, Isha) auf zwei Rakʿāt während der Reise wājib (verpflichtend). Das gilt, wenn man alleine oder mit einem Hanafi-Imam betet.
- Regel beim Beten hinter einem Imam: Der Prophet ﷺ sagte: „Der Imam ist nur dazu da, gefolgt zu werden.“ (Bukhari, Muslim). Das bedeutet: Wenn der Imam vier Rakʿāt betet, muss der Hanafi-Muqallid (Nachfolger) ebenfalls vier beten, auch wenn er Reisender ist.
- Besonderheit beim Schafiʿi-Imam: In der Schafiʿi-Schule ist das Kürzen (Qasr) nicht verpflichtend, sondern eine Erleichterung. Viele Schafiʿi-Reisende beten daher regulär vier Rakʿāt. Wenn ein Hanafi hinter einem solchen Imam betet, muss er sich anpassen und die vier Rakʿāt vollständig verrichten.
-
Praktische Konsequenz:
- Ein Hanafi-Reisender darf nicht nach zwei Rakʿāt Salam machen, wenn der Imam vier betet.
- Er muss mit dem Imam bis zum Ende beten, auch wenn dies bedeutet, dass er die Pflicht zum Kürzen nicht umsetzt.
- Das Gebet ist gültig und korrekt, da die Regel „Imam wird gefolgt“ Vorrang hat.
✅ Zusammenfassung
- Allein betend (Hanafi-Reisender): Pflicht, auf 2 Rakʿāt zu kürzen.
- Hinter einem Imam (egal ob ansässig oder Schafiʿi-Reisender, der 4 betet): Pflicht, die vollen 4 Rakʿāt zu beten.
- Begründung: Einheit der Gemeinde und Befolgung des Imams haben Vorrang.
Möchtest du, dass ich dir auch die Unterschiede zwischen Hanafi und Schafiʿi beim Reisen übersichtlich in einer Tabelle darstelle? Das könnte dir helfen, die Logik beider Schulen klarer zu sehen.
Translation
Purification (Tahaarah) from legal (hukmi) impurity (najasah) can only be achieved through the use of pure water, which has either fallen as rain or been stored in the earth, such as seawater, well water, or spring water. The liquids of trees (nectar) and fruits such as watermelon, grapes, or bananas are not suitable to bring something impure into the state of tahaarah.
If a foreign but pure substance such as sand, soap, or saffron enters the water, it is jayyid (permissible) to use this water for wudu’, unless the composition of the water has been so altered that its liquidity is lost, or the parts of water and addition have become equal (e.g., one liter of water and one liter of fruit juice), or the added substance is so dominant that one can no longer speak of water but rather of broth, rosewater, vinegar, etc. The ijmaaʿ (consensus of scholars) states that it is not permitted to perform wudu’ or ghusl with such a liquid. According to Imam Abu Hanifa, such liquids may, however, be used for cleaning clothes. Imams Muhammad and Shafiʿi, however, hold the opinion that this is not allowed.
Example: If coagulated and dried semen is scraped off clothing so that nothing remains visible, the clothing is considered pure.
Swords, knives, and similar items (such as a mirror) can be purified by mere wiping.
If the ground becomes dirty and then dries completely so that no trace of impurity remains, it is considered clean, and salah may be performed upon it. However, it is still not permitted to use this earth for tayammum (ritual sand purification). Likewise, walls, bricks, buildings, trees, and leaves (through drying and disappearance of impurity) become pure again. However, fallen leaves from a tree (or a brick broken off from a wall) only become pure once they have been washed.
Example: Visible impurity (or the affected surface) is, according to Imam Abu Hanifa, only purified once it has been washed away so that nothing remains visible. According to some other Imams, after the removal of visible impurity, the surface must be washed three times, and if possible wrung out each time. If this is not possible, the item must be left to dry after each washing until it no longer drips.
Invisible impurity must be washed at least three times (although seven times is best), wrung out, and dried each time before beginning the next wash.
Animal hides, when tanned (chemically or by the sun), become pure.
Example: Flowing water or large amounts of water (such as in a lake or large basin of at least 10 square feet) do not become impure by impurity falling into them or flowing into them, unless the impurity changes the taste, color, or smell of the water in a noticeable way.
Example: If a dog sits in flowing water, or something dead falls into it, or impurity is lodged somewhere and the water (on its way to the reservoir) flows over it, then this water becomes impure if the greater part of it comes into contact with the impurity; otherwise, it remains pure.
Example: A small amount of water becomes impure if impurity enters it.
Qullatain is approximately 225 sirs or about 210 liters. According to Imam Abu Hanifa, a large amount of water is defined as that which, when stirred on one side, is not immediately felt on the other side.
Example: If an animal falls into a well and drowns, and the carcass swells or bursts, the well must be completely emptied. If the carcass does not swell and the animal is the size of a cat or larger, the well must also be emptied. The same applies to three or more medium-sized animals (e.g., birds). If the dead animal is the size of a mouse or sparrow, 20 to 30 buckets of water must be removed from the well. If the dead animal is medium-sized (like a pigeon), then 40 to 60 buckets of water must be removed. Three sparrows are considered (juridically) equivalent to one pigeon. And Allah knows best.
👉 Möchtest du, dass ich dir auch eine tabellarische Übersicht der Unterschiede zwischen den Meinungen von Abu Hanifa, Muhammad und Shafiʿi zu diesem Thema erstelle? Das würde die Details noch klarer und vergleichbarer machen.
Kapitel Sechs:
Die Entfernung von Najaasat (Unreinheit)
Tahaarat (Reinheit) kann nicht von hukmi (rechtlicher) Najaasat erlangt werden außer durch die Verwendung von reinem Wasser, das vom Himmel gefallen ist (Regen) oder aus der Erde entspringt, wie Meerwasser, Brunnenwasser oder Quellwasser. Das Wasser (Saft) von Bäumen und Früchten – zum Beispiel von Wassermelone, Traube oder Banane – ist nicht geeignet, etwas Unreines in den Zustand von Tahaarat zu bringen.
Wenn eine fremde, jedoch reine Substanz wie Sand, Seife oder Safran ins Wasser gelangt, ist es jaiz (erlaubt), mit diesem Wasser Wudu zu verrichten – außer, die Konsistenz des Wassers wird dadurch so verändert, dass es seine Dünnflüssigkeit verliert oder im Verhältnis gleich wird mit der beigemischten Substanz (z. B. ein halber Liter Fruchtsaft und ein halber Liter Wasser), oder die beigemischte Substanz überwiegt derart, dass man nicht mehr von „Wasser“ spricht, sondern von Brühe, Rosenwasser oder Essig. Denn nach Ijmaaʿ (Konsens der Gelehrten) ist es nicht erlaubt, mit solch einer Flüssigkeit Ghusl oder Wudu vorzunehmen. Nach Imam Abu Hanifa dürfen solche Flüssigkeiten jedoch zur Reinigung von Kleidern verwendet werden. Die Imame Muhammad und Shafiʿi sind hingegen der Meinung, dass dies nicht erlaubt sei.
Masalah (Rechtsfall): Wenn getrockneter und geronnener Samen von einem Kleidungsstück abgeschabt wird, sodass nichts mehr sichtbar bleibt, gilt das Kleidungsstück als rein.
Schwerter und ähnliche Gegenstände (wie ein Spiegel) können durch bloßes Abwischen gereinigt werden.
Wenn der Boden unrein wird und dann austrocknet, sodass keine Spur der Najaasat mehr erkennbar ist, gilt er als rein geworden, und Salaah darf an diesem Ort verrichtet werden.
Weitere Masaa’il (Rechtsfälle)
- 4 Mashas (ca. 13 5/7 Dram): Wenn dicke Najaasat in dieser Menge auf Kleidung gelangt, ist dies entschuldbar (man darf in solcher Kleidung Salaah verrichten). Gelangt diese Menge jedoch ins Wasser, macht sie es unbrauchbar für Tahaarat.
- Reste von Speisen oder Getränken
(Speichelkontakt):
- Von Menschen, selbst Ungläubigen, von Pferden und von Tieren, deren Fleisch halal ist, sowie deren Schweiß, und auch der Schweiß von Eseln und Maultieren – all dies gilt als rein.
- Die Reste von Katzen, Mäusen und anderen Haustieren oder Schädlingen wie der Eidechse sowie die Reste von Vögeln, deren Fleisch haram ist (z. B. Falke, Geier), gelten als makruh (unerwünscht).
- Die Reste von Schwein, Hund, Elefant und anderen Vierbeinern, deren Fleisch haram ist (außer Katze und ähnliche Tiere, wie oben erwähnt), gelten als najaasat (unrein).
- Urinflecken: Winzige Tropfen, kaum sichtbar wie der Kopf einer Nadel, sind entschuldbar – solange die gesamte Fläche nicht größer ist als ein Dirham (wie zuvor erwähnt).
👉 Möchtest du, dass ich dir auch eine tabellarische Übersicht der verschiedenen Meinungen (Abu Hanifa, Muhammad, Shafiʿi) zu diesen Reinheitsregeln erstelle? Das würde die Unterschiede sehr klar und vergleichbar machen.
Die Entfernung von Najaasat (Unreinheit)
Tahaarat (Reinheit) kann nicht von hukmi (rechtlicher) Najaasat erlangt werden außer durch die Verwendung von reinem Wasser, das vom Himmel gefallen ist (Regen) oder aus der Erde entspringt, wie Meerwasser, Brunnenwasser oder Quellwasser. Das Wasser (Saft) von Bäumen und Früchten – zum Beispiel Wassermelone, Traube oder Banane – ist nicht geeignet, etwas Unreines in den Zustand von Tahaarat zu bringen.
Wenn eine fremde, jedoch reine Substanz wie Sand, Seife oder Safran ins Wasser gelangt, ist es jaiz (erlaubt), mit diesem Wasser Wudu zu verrichten – außer, die Konsistenz des Wassers wird dadurch so verändert, dass es seine Dünnflüssigkeit verliert oder im Verhältnis gleich wird mit der beigemischten Substanz (z. B. ein halber Liter Fruchtsaft und ein halber Liter Wasser), oder die beigemischte Substanz überwiegt derart, dass man nicht mehr von „Wasser“ spricht, sondern von Brühe, Rosenwasser oder Essig. Denn nach Ijmaaʿ (Konsens der Gelehrten) ist es nicht erlaubt, mit solch einer Flüssigkeit Ghusl oder Wudu vorzunehmen. Nach Imam Abu Hanifa dürfen solche Flüssigkeiten jedoch zur Reinigung von Kleidern verwendet werden. Die Imame Muhammad und Shafiʿi sind hingegen der Meinung, dass dies nicht erlaubt sei.
Masalah (Rechtsfälle)
- Samen: Wenn getrockneter und geronnener Samen von einem Kleidungsstück abgeschabt wird, sodass nichts mehr sichtbar bleibt, gilt das Kleidungsstück als rein.
- Metallgegenstände: Schwerter und ähnliche Dinge (wie ein Spiegel) können durch bloßes Abwischen gereinigt werden.
- Boden: Wenn der Boden unrein wird und dann austrocknet, sodass keine Spur der Najaasat mehr erkennbar ist, gilt er als rein geworden, und Salaah darf an diesem Ort verrichtet werden. Jedoch ist es nicht erlaubt, diese Erde für Tayammum zu verwenden.
- Wände, Bäume, Blätter: Wände, Ziegel, Bäume und Blätter werden durch das Austrocknen und Verschwinden der Najaasat wieder rein. Wenn Blätter vom Baum fallen oder Ziegel aus der Mauer brechen, werden sie erst durch Waschen rein.
Weitere Regeln
- Sichtbare Najaasat: Nach Imam Abu Hanifa gilt eine Oberfläche als rein, wenn die sichtbare Najaasat vollständig entfernt wurde. Andere Imame verlangen zusätzlich dreimaliges Waschen und, wenn möglich, Auswringen oder Trocknen zwischen den Waschungen.
- Unsichtbare Najaasat: Muss mindestens dreimal gewaschen werden (siebenmal ist besser), jedes Mal ausgewrungen oder getrocknet.
- Tierhäute: Werden durch Gerbung (chemisch oder durch die Sonne) rein.
- Fließendes oder großes Wasser: Fließendes Wasser oder große Wassermengen (z. B. See, Teich, großes Becken – mindestens ca. 10 Quadratfuß) werden nicht unrein, wenn Najaasat hineinfällt oder darüber hinwegfließt, außer die Najaasat verändert Geschmack, Farbe oder Geruch.
- Beispiele:
- Wenn ein Hund im fließenden Wasser sitzt, etwas Totes hineinfällt oder Wasser über Najaasat hinwegfließt: Das Wasser wird unrein, wenn der größere Teil davon mit der Najaasat in Berührung kommt; andernfalls bleibt es rein.
- Kleine Wassermengen werden unrein, sobald Najaasat hineinfällt.
- Große Wassermengen: Nach den meisten Imamen gilt qullatain (ca. 225 Sirs oder 210 Liter) als Grenze. Nach Imam Abu Hanifa gilt Wasser als „groß“, wenn eine Bewegung auf einer Seite nicht sofort auf der anderen Seite spürbar ist. Spätere Hanafi-Gelehrte haben dies vereinfacht mit der „10 mal 10“-Formel beschrieben.
- Wenn ein Tier in einen Brunnen fällt und
stirbt:
- Wenn der Kadaver anschwillt oder aufplatzt, muss der Brunnen vollständig geleert werden.
- Wenn er nicht anschwillt: Bei einem großen Tier (Katze oder größer) muss ebenfalls alles Wasser entfernt werden.
- Bei drei oder mehr mittelgroßen Tieren (z. B. Vögel) gilt dasselbe.
- Bei kleinen Tieren (Maus, Spatz) müssen 20–30 Eimer Wasser entfernt werden.
- Bei mittelgroßen Tieren (z. B. Taube) müssen 40–60 Eimer entfernt werden.
- Drei Spatzen gelten rechtlich als eine Taube.
Und Allah weiß es am besten.
👉 Soll ich dir auch eine kompakte Tabelle erstellen, die die Unterschiede zwischen Abu Hanifa und den anderen Imamen (Muhammad, Shafiʿi) zu diesen Reinheitsregeln darstellt? Das würde die Details noch übersichtlicher machen.
- Grundprinzip: Solange ein Gegenstand (z. B. ein Blatt am Baum oder ein Ziegel in der Mauer) fest mit seiner ursprünglichen Struktur verbunden ist, gilt er als Teil des Ganzen. Wenn er durch Austrocknen oder Verschwinden der Najaasah (Unreinheit) wieder rein wird, dann gilt die Reinheit für das Ganze – also auch für das Blatt am Baum oder den Ziegel in der Mauer.
- Wenn er sich löst: Sobald das Blatt vom Baum fällt oder der Ziegel aus der Mauer bricht, ist er ein eigenständiger Gegenstand. Er verliert den „Status“ als Teil des Ganzen. Damit gilt er nicht automatisch als rein, selbst wenn die Unreinheit auf der Oberfläche durch Trocknen verschwunden ist. → In diesem Fall muss er aktiv gewaschen werden, um als rein zu gelten.
- Praktische Konsequenz:
- Ein Baum mit Blättern, die durch Austrocknen von Unreinheit wieder rein geworden sind → die Blätter sind rein, solange sie am Baum hängen.
- Fallen die Blätter ab → sie müssen gewaschen werden, bevor man sie als rein betrachten kann.
- Gleiches gilt für Ziegel: In der Mauer können sie durch Trocknen rein werden. Brechen sie heraus, müssen sie gewaschen werden.
👉 Der Hintergrund ist, dass die Reinigung durch Austrocknen nur für fest verbundene Flächen gilt (Boden, Wände, Bäume). Sobald ein Teil davon abgetrennt wird, gilt er als „mobiles Objekt“ und benötigt eine eigene Reinigung durch Wasser.
Möchtest du, dass ich dir dazu ein kleines Schema zeichne (z. B. Baum mit Blättern → rein, abgefallenes Blatt → waschen), damit es visuell klarer wird?
📖 Bedeutung
- Arabisch: جَائِز (jāʾiz)
- Deutsch: erlaubt, zulässig, rechtmäßig, gestattet
🕌 Kontext in der islamischen Rechtswissenschaft (Fiqh)
- Wird verwendet, um auszudrücken, dass eine Handlung nicht verboten ist und somit rechtlich erlaubt bleibt.
- Es bedeutet nicht unbedingt „empfohlen“ oder „verdienstvoll“, sondern schlicht „es ist erlaubt / es ist möglich“.
- Beispiel: Es ist dschaiz, mit Wasser, dem etwas Reines beigemischt wurde, Wudu zu machen – solange es noch als Wasser gilt.
⚖️ Vergleich mit anderen Rechtsbegriffen
| Arabisch | Deutsch | Bedeutung |
|---|---|---|
| فَرْض (fard) | Pflicht | unbedingt vorgeschrieben |
| سُنَّة (sunna) | Sunna | empfohlen, verdienstvoll |
| مُبَاح (mubāḥ) | neutral erlaubt | weder empfohlen noch verpönt |
| جَائِز (jāʾiz) | erlaubt | zulässig, rechtmäßig |
| مَكْرُوه (makrūh) | verpönt | besser zu vermeiden |
| حَرَام (harām) | verboten | strikt untersagt |
👉 Kurz gesagt: „dschaiz“ = erlaubt / zulässig.
Möchtest du, dass ich dir auch die feinen Unterschiede zwischen „mubāḥ“ und „dschaiz“ erkläre? Sie werden oft synonym verwendet, haben aber in der Fachsprache kleine Nuancen.
I was in village mosques in Pakistan where the floor was covered with dried grass, consisting of many individual pieces; or, when I think of Austrian deciduous forests, where the ground—especially in autumn—is thickly covered with fallen, very clean leaves, it seems astonishing that one would not be allowed to pray there, since it would be impossible to wash the millions of leaves. Have you read or heard more about these legal circumstances?
Would you like me to also provide some context from Hanafi fiqh about why such surfaces (like leaves or grass) are treated differently depending on whether they are still connected to the ground or detached? That could clarify the reasoning behind these rulings.
🌿 Warum nicht alle Gebetsmatten aus Blättern als unrein gelten
- Unterscheidung zwischen „natürlicher Unreinheit“ und „potenzieller Unreinheit“: Die Regel bezieht sich auf Blätter oder Ziegel, die tatsächlich mit najasah (Unreinheit) in Berührung gekommen sind. Wenn sie einfach nur vom Baum gefallen sind, ohne Kontakt mit Unreinheit, gelten sie nicht als unrein.
- Reinigung durch Trocknung: Solange Blätter am Baum hängen, kann die Unreinheit durch Austrocknen verschwinden. Wenn sie abfallen, verlieren sie diesen „Status“ und müssen im Falle von Verunreinigung aktiv gewaschen werden. Aber: Saubere Blätter, die nie mit Unreinheit in Berührung kamen, sind von Natur aus rein.
- Fiqh-Prinzip: Dinge werden nicht automatisch als najas eingestuft, nur weil sie sich vom Ursprung lösen. Sie gelten nur dann als unrein, wenn sie tatsächlich mit Unreinheit in Kontakt waren.
🕌 Praktische Konsequenz
- Gebetsmatten aus Palmblättern, Bambus oder Gras gelten als rein, solange sie nicht mit najasah verunreinigt wurden.
- Die Regel von Qadhi Thana Ullah ist eine Vorsichtsmaßnahme: Wenn ein Teil der Erde oder der Wand sich löst, verliert er die „Reinigung durch Trocknung“ und muss im Zweifel gewaschen werden.
- Es geht also nicht darum, dass jedes Blatt oder jede Matte automatisch unrein wäre, sondern darum, dass die Reinigung durch Trocknung nur für fest verbundene Flächen gilt.
👉 Kurz gesagt: Blätter und Matten sind rein, solange sie nicht mit Unreinheit in Berührung kamen. Die Vorschrift von Qadhi Thana Ullah betrifft nur den Sonderfall, wenn Unreinheit vorhanden war und durch Trocknung verschwand – dann gilt die Reinigung nur für fest verbundene Flächen, nicht für abgetrennte Teile.
Möchtest du, dass ich dir dazu eine kleine Übersichtstabelle mache, die zeigt:
- „Fest verbunden“ vs. „Abgetrennt“
- „Mit Unreinheit in Berührung“ vs. „Nie verunreinigt“
Das würde die Logik noch klarer machen.
“Formally, Qadhi Thana Ullah explained it in this way, but I suspect there is more behind it, otherwise all prayer mats woven from leaves would be affected by najasah (impurity).”
Would you like me to also render this in a more polished, academic English style (e.g., suitable for a scholarly paper), or keep it as a direct translation?
Why not all prayer mats made of leaves are considered impure
Distinction between “natural impurity” and “potential impurity”: The rule applies to leaves or bricks that have actually come into contact with najasah (impurity). If they simply fall from the tree without contact with impurity, they are not considered impure.
Purification through drying: As long as leaves remain attached to the tree, impurity can disappear through drying. Once they fall, they lose this “status” and, in the case of contamination, must be actively washed. However, clean leaves that have never come into contact with impurity are naturally pure.
Fiqh principle: Objects are not automatically classified as najas simply because they separate from their origin. They are only considered impure if they have actually come into contact with impurity.
🕌 Practical consequence
Prayer mats made of palm leaves, bamboo, or grass are considered pure as long as they have not been contaminated with najasah.
The rule of Qadhi Thana Ullah is a precautionary measure: if a part of the earth or a wall becomes detached, it loses the “purification through drying” and must, in case of doubt, be washed.
Would you like me to also render this in a more formal academic English style (e.g., suitable for a scholarly article on fiqh), or keep it as a straightforward translation?
So the essential point is that when “wet najasah” dries on a leaf that has fallen from the tree, or on a brick that has come loose from the wall, these objects would have to be purified with water. But who can know whether on the dry leaf from the tree, upon which dried najasah is present but not visible, this is the case—and likewise with the brick? Or is it rather that if one does not know or see it, then it is considered pure?
Would you like me to also render this in a more formal scholarly English style (e.g., suitable for a fiqh commentary), where terms like najasah and taharah are kept in transliteration but explained in parentheses?
“Hanafis love improbable events.”
Would you like me to render this in a more nuanced scholarly English style, for example: “The Hanafi school tends to accommodate unlikely or improbable scenarios.”
This phrasing reflects how jurists often consider rare cases in their legal reasoning.
“… just as is the case when the prayer area is half inside the Haram and half outside of it.”
Would you like me to also render this in a more formal fiqh-style English, for example: “… similar to the situation where the place of prayer lies partly within the boundaries of the Haram and partly outside of it.”
„Die Regel von Qadhi Thana Ullah ist eine Vorsichtsmaßnahme: Wenn sich ein Teil der Erde oder einer Wand löst, verliert er die ‚Reinigung durch Trocknung‘ und muss im Zweifelsfall mit Wasser gewaschen werden.“
Möchtest du, dass ich dir auch eine vereinfachte Erklärung dazu gebe, damit der Sinn dieser Vorsichtsmaßnahme im praktischen Alltag klarer wird?
„Wenn sich ein Blatt vom Baum löst oder etwas Erde vom Boden genommen wird, bleibt es rein, solange nicht bekannt ist, dass es mit Najaasah (Unreinheit) in Berührung gekommen ist. Wenn danach die Spuren verschwinden, bleibt es dennoch najis (unrein), bis es mit Wasser gewaschen wird.“
Möchtest du, dass ich dir auch eine vereinfachte Erklärung dazu gebe, damit die Logik dieser Regel im praktischen Alltag klarer wird?
„Die Wahrheit ist, dass Abu Hanifah darauf bestand, dass die Fuqahaa (Rechtsgelehrten) auf jede Eventualität vorbereitet sein müssen, falls ein solcher Fall eintreten sollte. Daher stellten sie schwierige und seltene Fälle hypothetisch auf, von denen einige bis heute noch nicht eingetreten sind. Malik hingegen war abgeneigt, seltene Fälle zu beantworten oder überhaupt zu erwägen, solange sie nicht tatsächlich eingetreten waren. Zwei unterschiedliche Standpunkte.“
Möchtest du, dass ich dir diese beiden Methoden im Fiqh (Hanafi vs. Maliki) auch in einer kleinen Vergleichstabelle darstelle? Das würde die Unterschiede noch klarer machen.
📖 Hintergrund
- Qullatain‑Maß (Shafiʿi, Hanbali, andere): Viele Imame setzen die Grenze für „viel Wasser“ bei qullatain (ca. 225 Sirs ≈ 210 Liter).
- Abu Hanifa: Er definierte „viel Wasser“ nicht über ein Volumen, sondern über die Bewegungskriterien: Wenn man Wasser auf einer Seite bewegt und diese Bewegung nicht sofort auf der anderen Seite spürbar ist, gilt es als „groß“.
- Spätere Hanafi‑Gelehrte: Um
diese eher subjektive Definition greifbarer zu
machen, führten sie die „10×10‑Formel“
ein:
- Ein Wasserbecken mit einer Oberfläche von 10 Ellen × 10 Ellen (ca. 5 m × 5 m)
- und einer Tiefe, bei der das Wasser nicht sofort aufgebraucht oder der Boden sichtbar wird, gilt als „groß“.
🕌 Bedeutung in der Praxis
- Großes Wasser: Wird nicht unrein, wenn Najasah hineinfällt, solange Geschmack, Farbe oder Geruch nicht verändert werden.
- Kleines Wasser: Wird sofort unrein, wenn Najasah hineinfällt – auch wenn keine Veränderung sichtbar ist.
- Die 10×10‑Formel: Sie ist also ein praktisches Maß, das die abstrakte Definition Abu Hanifas („Bewegung nicht sofort spürbar“) in eine konkrete Größe übersetzt.
⚖️ Vergleich
| Schule | Grenze für „viel Wasser“ | Maß |
|---|---|---|
| Shafiʿi / Hanbali | Qullatain | ca. 210 Liter |
| Abu Hanifa | Bewegungskriterium | keine feste Zahl |
| Spätere Hanafis | 10×10‑Formel | ca. 5 m × 5 m Fläche, ausreichende Tiefe |
👉 Damit ist die „10×10‑Formel“ eine didaktische Vereinfachung innerhalb der Hanafi‑Tradition, um die Praxis klarer zu regeln.
Möchtest du, dass ich dir auch eine grafische Skizze (Schema eines Beckens mit 10×10‑Maßen) erstelle, damit die Vorstellung noch anschaulicher wird?
🕌 Arabisch – Deutsch
- جَائِز (jāʾiz)
- Deutsch: erlaubt, zulässig, gestattet, rechtmäßig
📖 Verwendung im islamischen Fiqh
- Wird gebraucht, um auszudrücken, dass eine Handlung nicht verboten ist.
- Es bedeutet nicht unbedingt „empfohlen“ oder „verdienstvoll“, sondern schlicht: „Es ist erlaubt.“
- Beispiel: Es ist dschaiz, mit Wasser Wudu zu machen, dem eine reine Substanz beigemischt wurde – solange es noch als Wasser gilt.
⚖️ Vergleich mit anderen Rechtsbegriffen
| Arabisch | Umschrift | Deutsch | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| فَرْض | fard | Pflicht | unbedingt vorgeschrieben |
| سُنَّة | sunna | Sunna | empfohlen, verdienstvoll |
| مُبَاح | mubāḥ | neutral erlaubt | weder empfohlen noch verpönt |
| جَائِز | jāʾiz | erlaubt | zulässig, rechtmäßig |
| مَكْرُوه | makrūh | verpönt | besser zu vermeiden |
| حَرَام | harām | verboten | strikt untersagt |
👉 Kurz gesagt: جَائِز (dschaiz) = erlaubt / zulässig.
Möchtest du, dass ich dir auch die feinen Unterschiede zwischen „mubāḥ“ und „jāʾiz“ erkläre? Sie werden oft synonym verwendet, haben aber in der Fachsprache kleine Nuancen.
📖 Historische Positionen
- Imam Abu Hanifa (gest. 767): Er betonte, dass Kleidung in erster Linie die ʿAwrah (zu bedeckende Körperteile) verhüllen muss. Die konkrete Form der Kleidung war für ihn kulturell flexibel, solange sie nicht gegen islamische Prinzipien verstößt.
- Imam Malik (gest. 795): Malik war stark von den Gewohnheiten in Medina geprägt. Er akzeptierte Kleidung, die den lokalen Bräuchen entsprach, solange sie die religiösen Anforderungen erfüllte.
- Imam al‑Shafiʿi (gest. 820): Auch er hielt fest, dass Kleidung nicht transparent sein darf und die ʿAwrah bedecken muss. Er sah keine Pflicht für eine bestimmte Art von Kleidungsstück, sondern ließ Raum für kulturelle Anpassung.
- Imam Ahmad ibn Hanbal (gest. 855): Ahmad betonte Bescheidenheit und Einfachheit, aber auch er sah keine bestimmte Form vorgeschrieben. Wichtig war, dass Kleidung nicht zur Arroganz oder Nachahmung von unislamischen Praktiken führt.
🕌 Prinzipien der Gelehrten
- Flexibilität: Kleidung ist nicht auf ein bestimmtes Design oder eine bestimmte Farbe festgelegt.
- Kulturelle Anpassung: Sie darf den lokalen Bräuchen angepasst werden, solange die islamischen Mindestanforderungen erfüllt sind.
- Fiqh‑Grundsatz: „Al‑ʿādah muhakkamah“ – Gewohnheit und Brauch haben Rechtskraft, solange sie nicht gegen die Scharia verstoßen.
📌 Beispiel aus den Quellen
- Der Qur’an spricht von „Libās at‑Taqwā“ (Gewand der Frömmigkeit) [Qur’an 7:26], was zeigt, dass die innere Haltung wichtiger ist als ein bestimmtes Kleidungsstück.
- Gelehrte wie Sheikh Muhammad Iqbal Nadvi betonen bis heute, dass Kleidung zwei Zwecke erfüllen muss: Bedeckung der ʿAwrah und angemessene Zierde.
Fazit: Frühere islamische Gelehrte haben keine bestimmte Kleidung vorgeschrieben, sondern nur die Grundregeln festgelegt. Die Anpassung an Kultur, Klima und Zeit war ausdrücklich erlaubt, solange die Scharia‑Prinzipien eingehalten werden.
Quellen:
👉 Soll ich dir eine Tabelle mit den vier Rechtsschulen erstellen, die zeigt, wie jede Schule die Anpassung von Kleidung an Kultur und Zeit bewertet? Das würde die Unterschiede sehr übersichtlich machen.
📖 Grundprinzip
- Der Prophet ﷺ sagte: „Wer ein Volk nachahmt, gehört zu ihnen.“ (Abu Dawud, Ahmad)
- Dieses Hadith wird von den Gelehrten als Warnung verstanden: Muslime sollen ihre religiöse Identität bewahren und nicht bewusst die spezifischen religiösen oder kulturellen Zeichen der Nichtmuslime übernehmen.
🕌 Kleidung im Detail
- Erlaubt: Kleidung, die kulturell üblich ist, aber keine religiöse oder identitätsstiftende Besonderheit der Nichtmuslime darstellt. Beispiel: Hemd, Hose, Mantel – solange sie die Scharia‑Regeln (Bedeckung der ʿAwrah, keine Durchsichtigkeit, keine Arroganz) erfüllen.
- Verboten: Kleidung, die direkt mit religiösen Symbolen oder Ritualen der Nichtmuslime verbunden ist (z. B. Priestergewand, Kreuz, bestimmte Mönchskutten).
- Umstritten / vorsichtig zu behandeln: Kleidung, die stark als „Markenzeichen“ einer nichtmuslimischen Kultur gilt, wenn sie bewusst zur Identifikation mit dieser Kultur getragen wird.
⚖️ Positionen der Gelehrten
- Hanafis: betonen, dass Kleidung kulturell flexibel ist, solange die islamischen Mindestanforderungen erfüllt sind. Nachahmung wird problematisch, wenn sie Absicht ist oder religiöse Symbole betrifft.
- Malikis: waren besonders vorsichtig mit dem Nachahmen von Nichtmuslimen, da sie die Identität der Muslime in Medina schützen wollten.
- Shafiʿis und Hanbalis: stimmen überein, dass Nachahmung in religiösen Symbolen verboten ist, aber kulturelle Kleidung (z. B. regionale Tracht) erlaubt bleibt.
🕌 Zusammenfassung
- Kleidung darf kulturell angepasst werden.
- Verboten ist die Nachahmung in religiösen Symbolen oder identitätsstiftenden Merkmalen der Nichtmuslime.
- Neutral ist das Tragen von allgemein üblicher Kleidung, solange die Scharia‑Regeln eingehalten werden.
👉 Kurz gesagt: Nicht die Form der Kleidung ist entscheidend, sondern die Absicht und die Symbolik.
Möchtest du, dass ich dir eine klare Tabelle mache, die zeigt:
- „Erlaubt“
- „Verboten“
- „Umstritten“ mit Beispielen für Kleidung? Das würde die Unterschiede sehr anschaulich machen.
📖 Aussagen früher Gelehrter
- Hadith-Basis: Der Prophet ﷺ sagte: „Wer ein Volk nachahmt, gehört zu ihnen.“ (Abu Dawud). Dieses Hadith war die Grundlage für die Diskussion über Kleidung und Nachahmung.
- Ibn Taymiyyah (gest. 1328): Er erklärte, dass Nachahmung in religiösen Symbolen oder Festen mindestens haram sei, und im Extremfall sogar zum Unglauben führen könne, wenn man bewusst religiöse Praktiken übernimmt.
- Imam Malik (gest. 795): Er war besonders vorsichtig mit kultureller Nachahmung. Kleidung, die stark mit nichtmuslimischen Ritualen verbunden war, lehnte er ab.
- Imam Abu Hanifa (gest. 767): Er sah Kleidung als kulturell flexibel, solange die Scharia-Regeln eingehalten werden. Nachahmung wurde problematisch, wenn sie Absicht war oder religiöse Symbole betraf.
- Imam al-Shafiʿi (gest. 820) und Imam Ahmad ibn Hanbal (gest. 855): Beide betonten, dass Kleidung, die die ʿAwrah bedeckt und keine religiösen Symbole trägt, erlaubt ist. Nachahmung in religiösen Merkmalen wurde jedoch strikt abgelehnt.
🕌 Prinzipien der frühen Gelehrten
- Erlaubt: Kleidung, die kulturell üblich ist und keine religiöse Bedeutung hat (z. B. Hemd, Hose, Mantel).
- Verboten: Kleidung mit religiösen Symbolen oder Ritualbezug (z. B. Priestergewand, Kreuz, Mönchskutte).
- Umstritten: Kleidung, die stark als „Markenzeichen“ einer nichtmuslimischen Kultur gilt, wenn sie bewusst zur Identifikation getragen wird.
Frühe islamische Gelehrte sahen Nachahmung in religiösen Symbolen als strikt verboten, während sie kulturelle Anpassung in Kleidung erlaubten, solange die islamischen Mindestanforderungen (Bedeckung der ʿAwrah, keine Durchsichtigkeit, keine Arroganz) erfüllt waren.
📖 Grundgedanke
- Viele frühe Gelehrte betonten, dass Muslime ihre eigene religiöse Identität bewahren sollen.
- Das bedeutet nicht, dass ein Muslim äußerlich völlig anders aussehen muss, sondern dass er nicht bewusst die religiösen oder identitätsstiftenden Symbole der Nichtmuslime übernimmt.
🕌 Kleidung und Erscheinung
- Pflicht: Bedeckung der ʿAwrah, Bescheidenheit, keine Durchsichtigkeit, keine Arroganz.
- Verboten: Nachahmung in religiösen Symbolen (z. B. Kreuz, Priestergewand, Mönchskutte).
- Neutral/erlaubt: Allgemeine Kleidung, die kulturell üblich ist (z. B. Hemd, Hose, Mantel), solange sie die Scharia‑Regeln erfüllt.
⚖️ Positionen der Gelehrten
- Ibn Taymiyyah schrieb, dass Muslime sich in religiösen Symbolen und Festen klar unterscheiden sollen, um ihre Identität zu bewahren.
- Imam Malik war besonders vorsichtig und lehnte Kleidung ab, die stark mit nichtmuslimischen Ritualen verbunden war.
- Abu Hanifa, Shafiʿi, Ahmad akzeptierten kulturelle Anpassung, solange die islamischen Mindestanforderungen eingehalten wurden.
Ein Muslim muss nicht äußerlich völlig anders aussehen als ein Nichtmuslim auf der Straße.
- Unterscheidung ist notwendig in religiösen Symbolen und Praktiken.
- Äußere Ähnlichkeit in neutraler Kleidung ist erlaubt.
- Entscheidend ist die Absicht: Wenn man Kleidung trägt, um bewusst eine nichtmuslimische religiöse Identität nachzuahmen, ist das problematisch.
👉 Kurz gesagt: Ein Muslim sollte durch seine Identität, Glauben und Praxis unterscheidbar sein, nicht zwingend durch jedes Kleidungsstück.
Möchtest du, dass ich dir eine Tabelle mit Beispielen mache, die zeigt:
- erlaubt (neutral)
- verboten (religiöse Symbole)
- umstritten (kulturelle Marker) Das würde die Unterschiede sehr anschaulich machen.

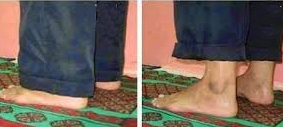
 Ob man das weiß oder nicht, die Krawatte ist zum Symbol der
demokratischen Religion geworden. Der Turban hingegen ist Symbol und Ehre für
Muslime. Aber wie verwirrt ist jemand, der beides zugleich trägt, wobei die
Krawatte das Echte, Bleibende ist und der Turban, das Unechte, showbedingte. Eine Krawatte
ist dann echt wenn sie vom Träger gebunden wurde, also kein Klipp ist. Ein
Turban ist dann echt, wenn er vom Träger gebunden wurde und kein
Fertigprodukt (also kein Hut) ist. Das was echt ist (die Krawatte) lässt der Präsident halb
versteckt unterm Showumhang hervorschauen um sie nach seiner säkularen Show
wieder voll zu zeigen. Was aber unecht ist (sein Turban), den nimmt er nach
der säkularen Show wieder ab. Unwissenheit darf angenommen werden,
Lernfähigkeit ist nicht zu erwarten. In der Türkei ist der Islam spätestens seit
Atatürk zu einer (säkularen) Kirche entstellt worden und bis heute so geblieben. Wie
also sollte dem türkisch geschulten Präsidenten auffallen, dass der
"anerkannte Islam" Österreichs ebenfalls eine (islamrechtlich illegale)
Kirche ist. Da er und Gleichgesinnte dieses
Ob man das weiß oder nicht, die Krawatte ist zum Symbol der
demokratischen Religion geworden. Der Turban hingegen ist Symbol und Ehre für
Muslime. Aber wie verwirrt ist jemand, der beides zugleich trägt, wobei die
Krawatte das Echte, Bleibende ist und der Turban, das Unechte, showbedingte. Eine Krawatte
ist dann echt wenn sie vom Träger gebunden wurde, also kein Klipp ist. Ein
Turban ist dann echt, wenn er vom Träger gebunden wurde und kein
Fertigprodukt (also kein Hut) ist. Das was echt ist (die Krawatte) lässt der Präsident halb
versteckt unterm Showumhang hervorschauen um sie nach seiner säkularen Show
wieder voll zu zeigen. Was aber unecht ist (sein Turban), den nimmt er nach
der säkularen Show wieder ab. Unwissenheit darf angenommen werden,
Lernfähigkeit ist nicht zu erwarten. In der Türkei ist der Islam spätestens seit
Atatürk zu einer (säkularen) Kirche entstellt worden und bis heute so geblieben. Wie
also sollte dem türkisch geschulten Präsidenten auffallen, dass der
"anerkannte Islam" Österreichs ebenfalls eine (islamrechtlich illegale)
Kirche ist. Da er und Gleichgesinnte dieses




